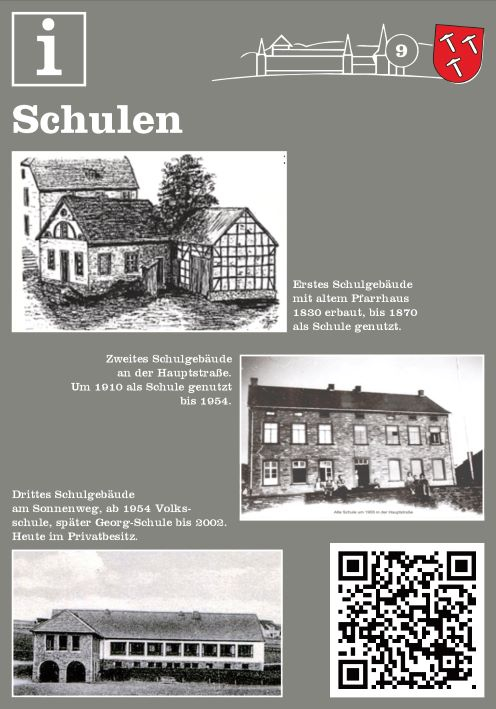
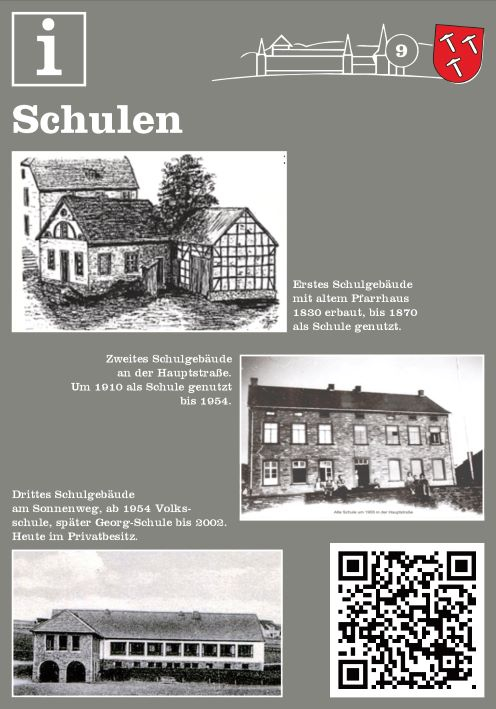
9. Schulen
Die tüchtige Reichsgräfin Augusta kümmert sich darum, dass um 1780 ein geordneter Schulunterricht stattfinden kann, und dass die Kinder armer Eltern kein Schulgeld bezahlen müssen. Die von ihr gegründete höhere Schule in Blankenheim wird von etwa 20 Schülern besucht.
Die vermutlich erste Schule stand im Südteil des Dorfes und wurde 1836 zur Versteigerung ausgeschrieben, um die Kosten für eine neue Schule in Schmidtheim, die 1836 unterhalb der Kirche erbaut wurde, zu reduzieren. Dieses Gebäude wurde bis 1876 als Schule genutzt. Sie bestand aus dem Schulsaal und für den Lehrer aus Wohnzimmer, Küche und zwei Dachzimmerchen.
Es gab keine Schulpflicht. Viele Eltern schickten ihre Kinder nicht zur Schule, damit sie schon im Kindesalter zuhause mitarbeiten konnten. Manche Kinder kamen nur im Winter, um sich auszuruhen und aufzuwärmen, konnten dem Unterricht aber nicht gut folgen, weil sie Monate vorher nicht teilgenommen hatten. Die Eltern und Großeltern hatten keine bzw. kaum eine Schule besucht. Es gab kein Radio und kein Fernsehen, keine Tageszeitung, keine Lektüre. Die Kinder konnten außerhalb der Schule von niemandem etwas lernen. Die Erwachsenen, die trotzdem lesen, schreiben und rechnen gelernt hatten, bekamen direkt Anstellungen z.B. bei der Bahn.
Für 95 % der Kinder war Hochdeutsch eine Fremdsprache.
Die nächste Generation von Kindern ging um 1910 in die damals neue Schule am alten Feuerwehrhaus im Oberdorf an der Hauptstraße. Es gab zwei große Klassenräume und zwei Lehrerwohnungen im Obergeschoss. Zu dieser Zeit stieg die Schülerzahl rapide an, denn der Schulbesuch war inzwischen Pflicht geworden. Es wurden deshalb drei Klassen gebildet. Fräulein Maria Buchholz unterrichtete das 1. und 2. Schuljahr und nachmittags die Mädchen der Oberklasse in Haus- und Handarbeit. An der Schule wurde ein Nutzgarten angelegt, in dem in praktischer Arbeit u.a. das Säen und Setzen von Pflanzen gelehrt wurde, später das Ernten, Einlegen und Einwecken von Früchten. Lehrer Hoffmann unterrichtete die 3., 4. und 5. Klasse. Lehrer Franck gab den Schülern der Oberklassen 6, 7 und 8 Unterricht, am Nachmittag in Rechnen und Raumlehre. Trotz aller Verbesserungen im Schulsystem fehlten viele Kinder auch in dieser Zeit wegen Arbeit und Krankheit. Die Mädchen der Oberklasse mussten zuhause bleiben, wenn die Mutter ein Kind erwartete oder krank war. Die Jungen mussten im Frühjahr bei der Feldbestellung helfen, im Sommer und im Herbst bei der Ernte.
Am 01. April 1944 wurden zwar die Kinder des Jahrgangs 1938 noch eingeschult. Aber es war ein Problem, Tafel und Schulranzen zu beschaffen. Schulneulinge mussten sich mit großen Taschen der entlassenen Schüler aushelfen. Die neuen kleinen Schülerinnen und Schüler beobachteten gespannt, wie die größeren Schüler in "Reih und Glied" zum Sportplatz marschierten und Soldatenlieder sangen. Zwei Wochen nach der Einschulung wurde die Volksschule geschlossen. Anfang Juli 1944 besuchten die Kinder noch einmal die Schule zusammen mit ihren Eltern: Es wurden Gasmasken ausgegeben. Die Masken waren für die nächsten Wochen das bevorzugte Spielzeug für die Kinder.
Der Unterricht hatte sich nach dem Krieg 1945 stark verändert. Zum Schulbeginn wurde wieder ein Gebet gesprochen, 2x in der Woche war Schulmesse, der Pastor unterrichtete Religion. Der Schulalltag war von vielen Mängeln geprägt. Die wenigen Lehrmittel waren während des Krieges zerstört oder beschädigt worden. Eine große Landkarte wurde mit Pflaster repariert, der Globus war eingedrückt und ließ sich nicht mehr drehen. Das einzige "Gerät", was laufend erneuert wurde, war der Prügelstab. Schulbücher gab es nicht oder sie wurden von den Geschwistern oder den Eltern übernommen. Diese Bücher waren nicht einheitlich. Es gab keine Tafeln. Alle schrieben mit einem Stahlstift auf einer Dachschieferplatte. Später gab es dann "Papp-Tafeln" mit roten Linien, auf die mit einem weißen Stift geschrieben wurde. Viele Kinder kamen im Winter nicht zur Schule, weil ihre einzigen Schuhe beim Schuster waren.
Für heutige Verhältnisse waren die sanitären Einrichtungen eine Katastrophe: Die Toilette bestand aus einem Raum von ca. 2,50 x 4,00m Größe mit einem kleinen Fenster, einer kleinen Tür und einer Trittstufe nach unten. Es gab keinen Wasserhahn und kein Waschbecken. In Winkelform war eine kleine Rinne aus Beton für die kleine Notdurft hergerichtet. An der rückseitigen Wand befand sich ein ca. 3 Meter breiter Holzkasten, der oben vier Öffnungen enthielt, die mit je einem Holzdeckel mit Holzknopf abgedeckt waren. Diese, von den Kindern "Donnerbalken" genannte Einrichtung für das "größere Geschäft", war mit dunkelroter Ölfarbe gestrichen. Alles plumpste in eine große Grube, die oft randvoll war.
Die Jugend hatte direkt nach dem Krieg keine Möglichkeit, weiterführende Schulen in Schleiden oder Euskirchen zu besuchen, da der Zugverkehr gestört war. Herr Johann Müller (1924-1989) eröffnete daher eine Ein-Mann-Privatschule, in der 30 Jungen und Mädchen in den Fächern: Deutsch, Mathematik, Stenografie und Handelskunde unterrichtet wurden.
1946 richtete für 18 Monate Dr. Heinz Renn, Studienrat, in seinem Wohnzimmer in Schmidtheim, in der heutigen Straße "Im Wiesental", eine Privatschule ein. Er unterrichtete Latein, Mathematik und Deutsch, Geschichte und Griechisch, damit seine Schülerinnen und Schüler die Aufnahme für das Gymnasium schafften.
Um 1948/49 wurden die schlechtesten Schulbänke endlich repariert und angestrichen. Deshalb zog der Lehrer mit der Mittelklasse links am Weiher vorbei in ein Waldstück. Die Schüler mussten sich auf den Boden setzen und auf den Knien ihre Aufgaben machen. Das Gebäude wurde bis 1954 als Volksschule genutzt.
Anschließend eröffnete die Firma Springer in dieser Schule einen Nähbetrieb. Hier wurde bis 1962 Sportbekleidung wie Anoraks, Hosen u.ä. für Damen, Herren und Kinder gefertigt. 1961 expandierte die Firma und investierte in den Neubau eines Fabrikgebäudes in der Bahnhofstraße, dem heutigen Bürgerhaus. Zeitweise waren bis zu 80 Frauen und zwei Männer aus Schmidtheim und Umgebung hier beschäftigt. 1980 beendete die Firma Springer ihren Betrieb.
1954 entstand ein neues Schulzentrum mit Lehrerwohnungen am Sonnenweg und diente als Volksschule bis 1966. Nach großzügig angelegten Schulreformen und nach der Bildung der Gemeinde Dahlem 1972 wurden alle Dorfschulen geschlossen und im Hauptort Dahlem eine zentrale Grund- und Hauptschule errichtet. Anschließend wurde das Schulzentrum bis 2002 Georg-Schule des Sonderschulzweckverbandes.
Heute ist das Gebäude zu Wohnungen umgebaut und befindet sich in Privatbesitz.